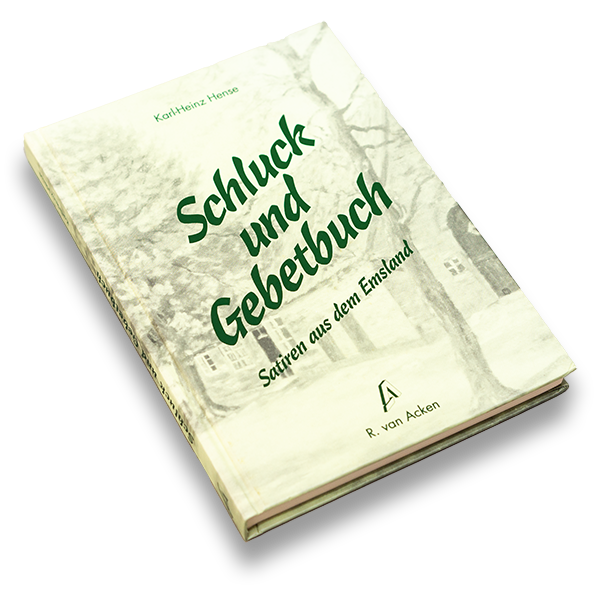
Der Dorfschullehrer
Zu der Zeit, als der Dorfschullehrer Rafael Maria Gries in Amt und Würden war, besaß eine Kneipe des schönen, plattdeutschen Emslandes gottseidank noch ihre ureigenen und unverwechselbaren Qualitäten. Man redete unter Eingeweihten nicht von Gaststätten oder Wirtshäusern schlechthin, nein, man nannte die bewußten Etablissements stets liebevoll bei ihren vielversprechenden Eigennamen: „Zum schmierigen Löffel“; „In Düwels Köcken“; „Heinekens Laupstall“ oder auch, prosaischer, „Zum Eselswirt“. Wenn man sich einen genehmigen wollte, dann hieß es also nicht einfach: „Ich geh jetzt mal ins Wirtshaus“, man sagte zum Beispiel: „Ebm in Heinekens Laupstall, ’n Kleinen nemmen!“
Ja, so war es, als Rafael Maria Gries in der Blüte seiner Mannesjahre stand. Keiner der bewußten Örtlichkeiten haftete die für unsere Zeit so bezeichnende, kalte Unpersönlichkeit an. Damals, als der wackere Dorfschullehrer seine Schüler noch, wie er sich auszudrücken pflegte, im niederdeutschen Dreikampf: Lesen, Schreiben und Rechnen, trainierte, hatte es nichts Zweifelhaftes, Ungehöriges oder gar Anrüchiges, wenn jemand, und oblag ihm auch die Erziehung der Jugend, sich täglich in seiner Kneipe wie in Abrahams Schoß behütet und geborgen fühlte. – Rafael Maria Gries war mit besonderem Vorzug bedacht: Das Gefühl der Geborgenheit genoß er nicht nur in einer, sondern gleich in mehreren der fraglichen Lokalitäten.
Die Wirtsleute wußten die Pflege, die der Lehrer ihren Kindern angedeihen ließ, durchaus zu schätzen, auch wenn ihn die Emsländer hinter seinem Rücken heimlich „Kleinkinderpopo-Bearbeitungsarchitekt“ nannten. In allen Häusern des hier in Rede stehenden Kirchspiels sprach man mit respektvoller Hochachtung von ihm, vor allem seit er seine Autorität dazu verwandt hatte, der Hochzeit von Rosa Wackelbüdel, älteste Tochter des stinkreichen, aber überaus knickerigen Bauern August Bernhard Wackelbüdel, zu einem rundum erfolgreichen und feuchtfröhlichen Gelingen zu verhelfen.
Diese erstaunliche Tat hatte er nicht nur dadurch vermocht, daß er voller Pathos ein eigens zu diesem feierlichen Anlaß verfaßtes Gedicht vortrug – es endete mit den sinnigen, vornehmlich an Rosas frisch angetrauten Gemahl Franz gerichteten Versen:
Macht die Rosa mal Theater,
weil dein Lebenswandel ihr nicht paßt,
höre nicht auf ihr Gequater,
wenn du noch einen unterm Korken hast!
Hier auf Erden findet alles
einmal den gerechten Lohn,
und im Falle dieses Hochzeitsfalles:
Franz und Rosa haben ihn wohl schon! –
nein, von dieser poetischen Leistung abgesehen hatte er sich besonders dadurch ins Ansehen aller Hochzeitsgäste gesetzt, daß er den Geizkragen und „Kniepsack“ August Bernhard dazu veranlassen konnte, neben dem billigen ,Kaunes Korn’ – von dem man augenzwinkernd das Sprüchlein aufsagte: „Kaunes Korn gibt keinen Kater!“ – einige Batterien guten ,Rasche’ kommen zu lassen. Zu solcher Verschwendung hatte den Alten nicht einmal jemand verführen können, als sein ältester Sohn Anton sich vermählte. Die Argumente des Lehrers aber und ein paar durch die Blume gesprochene Hinweise auf die teilweise prekäre Schulsituation seiner Enkel hatten Opas emsländische Knickerigkeit besiegt, so daß es diesmal zu einer richtigen Hochzeitsfeier mit ordentlichen Haselünner Spirituosen kommen konnte. – Böse Zungen indes wollen wissen daß den Brautvater die ungewöhnliche Großzügigkeit schon am nächsten Morgen reute, und er, um den schmerzenden Verlust wettzumachen, so lange beim Hochamt nur wertlose Hosenknöpfe zur Kollekte gegeben habe, bis der Pastor eines Tages von der Kanzel bekanntgab, daß er sich bald gezwungen sähe, on der Pfarrei einen Trödelladen zu eröffnen, weil er nicht mehr wisse, wohin mit den ganzen Hosenknöpfen, die allsonntäglich im Kollektenteller zu finden seien. –
Ob August Bernhard nun tatsächlich an dieser heidnischen Aktion beteiligt war oder nicht, sei dahingestellt. Tatsache ist, daß man dem Lehrer vom Zeitpunkt der Hochzeit an überall im Dorf ganz besonders freundlich begegnete. Seine erfolgreiche Intervention, welche sonstigen Weiterungen sie auch gehabt haben mag, stellte lange Zeit das beliebteste Gesprächsthema an allen Biertischen dar.
Natürlich genoß Rafael Maria den Zuwachs an Ansehen sehr. So sehr, daß der eingefleischte Junggeselle sogar eine amouröse Beziehung mit Liesbeth, der Wirtin vom „Schmierigen Löffel“ begann. Weil sie ihn jetzt wegen seiner Bravourleistung – und fast mehr noch wegen anderer, insbesondere bei Nacht zutage tretender Qualitäten – so bevorzugt bediente wie kaum je sonst einen ihrer Gäste, verblaßte in seiner Erinnerung endlich die peinliche alte Geschichte:
Dem jungen Lehrer, frisch dem Seminar entsprungen, war eben sein Amt in dem kleinen emsländischen Dorf angewiesen worden; er sprühte vor Arbeitseifer und war mit den besten Vorsätzen erfüllt. Auch daß seine Freunde von der Hochschule ihn mit dem dörflichen Leben, das ihn erwartete, aufzuziehen versuchten, konnte seine Zuversicht und sein Sendungsbewußtsein nicht schmälern. Ihren Sticheleien, die von Barbarei, Rückständigkeit und Unkultur auf dem Lande wissen wollten – sie sagten etwa, man habe dort gerade erst den aufrechten Gang eingeführt, man hole am Abend vorsichtshalber noch die Häuser in den Keller oder man versuche bei Nacht den Mond mit einer langen Stange zu vertreiben, diesen Sticheleien bot er unerschütterlich Paroli. Er hielt ihnen entgegen, daß man heutzutage auch im Emsland nicht mehr im achtzehnten Jahrhundert lebe, sondern längst Anschluß an das technische Zeitalter gefunden habe; was etwa durch den wachsenden Einsatz von Mähdreschern, Vollerntern und vollautomatischen Fütterungsanlagen bewiesen werde. –
Als die Freunde aber nicht aufhören wollten, über seinen zukünftigen Aufenthalts- und Wirkungsbereich Possen zu reißen, machte er ihnen den Vorschlag, ihn doch zu begleiten, dann könnten sie sich an Ort und Stelle davon überzeugen, daß es keine großen Unterschiede mehr gäbe zwischen Stadt und Land.
Einen der Spötter konnte er überreden, so daß sie wenige Tage später selbzweit an der Haltestelle vor der Kneipe Liesbeths dem Omnibus entstiegen. Das schon reichlich verwaschene, mit altdeutschen Lettern beschriftete Email-Schild „Gastwirtschaft zum Schmierigen Löffel“ vor Augen, brach der Freund in schallendes Gelächter aus und bemerkte spitz: „Bitte sehr, hier hast du die saubere Emsland-Kultur gleich schwarz auf weiß!“ „Blau auf gelb“, brummte Rafael Maria mit einem ärgerlichen Seitenblick auf den Reisebegleiter, „wohl farbenblind, was? Aber das hat nichts zu bedeuten. Lediglich Folklore. Komm, wir gehen mal rein. Können ja gleich ’ne Kleinigkeit essen. Wirst schon sehen, daß es hier viel besser schmeckt als in der Stadt!“
Also betrat man den Schankraum und wurde von der unverwechselbaren Originalität ländlicher Kneipen empfangen: gelblich verqualmte Gardinen, Tapeten undefinierbarer Farbe, romantisch verstaubte Fensterbänke, Ofenrohre, von denen die Silberbronze malerisch abblätterte, formschön eingesessene Stuhlkissen, Tischplatten mit einem Kreismuster von Glasrändern, die sanfte Hügellandschaft des ausgetretenen Bohlenfußbodens, mühsam sich senkrecht haltende Thekenschemel, das milde Licht trüber Fensterscheiben und schummerige Moorkatenatmosphäre. – Rafael Maria wurde etwas mulmig zumute; betreten sah er sich um. Jetzt wurde er allmählich doch geneigt, den Freunden zuzustimmen. – Er spürte jene unverfälschte Seele, die Räume dieser Art atmen, eben noch nicht. Erst lange Zeit später lernte er ihre warme Patina von Geborgenheit und Heimat schätzen; jene betörende Aura, die den Gegenpol bildet zum bedrückenden Alltag und eine geheimnisvolle Anziehungskraft zu besitzen scheint, der die Sinne bedingungslos ausgeliefert sind.
Damals indessen war es ihm höchst unangenehm, sich mit seinem Freund an einen der Tische zu setzen, auf Stühle, deren Kissen sich nicht die geringste Mühe gaben, frisch gewaschen auszusehen. Aber er brachte es klaglos über sich; den vielsagenden Blicken seines Begleiters freilich wagte er nicht zu begegnen. –
Nach einiger Zeit erschien hinter dem Tresen, vom schrillen Geklingel der Türglocke herbeigelockt, die damals achtzehnjährige Liesbeth, ein vollbusiges, stämmiges Emslandmädchen, rotwangig, flachsblond und das frische Gesicht von Sommersprossen übersät. Um den beiden Gästen zu Diensten zu sein, hatte sie ihre Arbeit im angegliederten Viehstall unterbrochen. Im Sonntagsstaat hätte sie den Freunden sicher sehr gefallen, aber so …
Sie trug über den unordentlich zusammengesteckten Haaren ein von Staub und Spinnweben bedecktes Kopftuch; halbhohe Gummistiefel mit Dreckrand schlackerten um die Füße, ließen dabei freilich den Blick auf zwei wohlgeformte, leicht ins Graue spielende Waden zu; eine grobe Sackleinenschürze, an der, auch für den Stadtmenschen nicht zu übersehen, hier und da Klümpchen eingetrockneten Kuhmists klebten, hatte sie sich um die Hüften geschlungen; und eine rotkarierte Bluse, die gewiß einmal sauberere Tage gesehen hatte, spannte über ihrer Brust. Auf diese emsländische Art herausgeputzt erschien sie vor den beiden feinen Pinkeln, wischte sich die schmutzigfeuchten Hände an besagter Schürze ab und fragte mit strahlendem Lächeln: ,,Tach, mine Herrn, un wat sollt dann wesen?” Rafael Maria überlegte krampfhaft, welches Getränk unter diesen Umständen am ehesten zu empfehlen sei, und bestellte schließlich mit belegter Stimme: „Äh … Schnaps“. Liesbeth nickte, begab sich munter hinter ihre Theke und kehrte umgehend mit einer Flasche Korn in der einen Hand und zwei ,Pinnken’ in der anderen zurück. Die kleinen Glasbecher trug sie in einem praktischen Haltegriff, der Rafael Maria allerdings in Anbetracht der Tatsache, daß man aus ihnen trinken sollte, den Schweiß des Entsetzens auf die Stirne trieb: Sie hatte kurzerhand zwei ihrer nicht eben schneeweißen Finger in die Gläschen gesteckt und transportierte sie auf diese Weise mühelos an den Tisch der beiden Herren. Dort stellte sie die Pinnkens und den Buddel mit einem herzlichen „Bittschön!“ ab.
Der Freund hatte Rafaels Mienenspiel beobachtet; um ihn vollends zu entgeistern, fragte er mit kaum verhohlener Schadenfreude nach der Möglichkeit, etwas zu essen zu bekommen. „Wat schollt denn wesen?“ fragte Liesbeth, die Freundlichkeit in Person. „Ja“, entgegne!e ihr Gast, „was gibt es hier bei euch denn so?“ „Spiegeleier hebbt wie immer!“ bot Liesbeth an. „Ja, gut“, war nach kurzem Zögern die Antwort, „dann vielleicht für jeden zwei.“ Als er sich aber den vermutlichen Zustand der Pfanne, in der diese Kost zubereitet werden würde, vorzustellen versuchte, rief er doc~ noch ~c~ell hinter der diensteifrig in die Küche Enteilenden her: „Äh … nein, lieber doch gekocht, wenn’s geht!“ „Ok gut!“ tönte es unter geschäftigem Topfklappem herein. Zu Rafael Maria gewendet fügte der Freund leiser hinzu: „Da sind wenigstens noch Schalen drum!“
Dann wollte man zum Schnaps kommen. Die beiden sahen zuerst die Pinnken und dann sich gegenseitig unschlüssig an. Die dickwandigen, schmuddligen Gläser stellten nicht gerade ein appetitanregendes Bild dar. Schließlich zog Rafael Maria seufzend ein blütenweißes Taschentuch hervor und reinigte sie gründlich, bevor er einschenkte. Die Blicke des Freundes wurden immer spöttischer, und als er demonstrativ sein Glas hob, um dem anderen mit einem ironischen Unterton in der Stimme zuzuprosten, zischte der ihm wütend entgegen: „Freust dich wohl, daß du recht hattest, was? Aber warte, ich werde aus diesem Volk noch zivilisierte Menschen machen!“ Der Freund quittierte die zornige Verbissenheit des jungen Lehrers mit einem einlenkenden Lachen. „Na ja“, sagte er, „mach dir nichts draus. Ist vielleicht ganz gut, daß dir die Flausen von Anfang an aus dem Kopf getrieben werden. Die Landschaft wenigstens ist doch ganz schön, und vielleicht sind wir von den Eiern auch angenehm überrascht.“
Überrascht waren die beiden allerdings, als nach zehn Minuten Liesbeth in der Tür erschien. – Und nun also ereignete sich jene Denkwürdigkeit, die Rafael Maria der wackeren Wirtin über viele Jahre nachtrug, weil sie seine Niederlage in den Augen des Freundes vollständig gemacht hatte und ihn an der Errettung der emsländischen Bevölkerung aus den Klauen der Barbarei verzweifeln ließ: Liesbeth trat an ihren Tisch, in jeder der weit vorgestreckten, immer noch nicht sehr reinlichen Hände zwei ihrer Schalen rundum beraubte, freilich keineswegs eiweiß zu nennende Eier, und vermeldete mit ihrem strahlendsten Apfelbäckchen-Gesicht: „Hier – jie Kerdls bint doch faken to unbeholpen, ick hebb se ju forts affpellt!“